|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
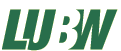 Die Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg erklärt auf seiner Webseite die Begriffe: Die Landesanstalt für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg erklärt auf seiner Webseite die Begriffe:sind alle Arten von mechanischen Schwingungen in festen Körpern. Sie können besonders störende Immissionen hervorrufen, die bis hin zu Beschädigungen von Gebäuden oder Bauteilen führen können. Erschütterungsimmissionen sind durch technische Vorgänge an schützenswerten Orten (z. B. innerhalb eines Wohngebäudes) auftretende Erschütterungen. Dadurch werden betroffene Gebäude und Bauteile dynamisch belastet. Erschütterungsimmissionen wirken aber auch auf Menschen ein, die sich in betroffenen Gebäuden aufhalten. Erschütterungen können Belästigungen von Menschen bewirken und Schäden an Sachgütern verursachen. Tieffrequente Geräusche sind Geräusche mit vorherrschenden Energieanteilen unterhalb einer Frequenz von etwa 90 Hertz bis in den Bereich des Infraschalls. Sie können Grund für erhebliche Belästigungen sein. Zu Zeiten allgemeiner Ruhe wie z. B. in der Nacht werden sie oftmals als besonders störend empfunden. Die Beurteilung tieffrequenter Geräusche erfolgt i. a. nach der DIN 45680. Tieffrequente Geräusche können sich von der Quelle durch Körperschall oder Luftschall in die Nachbarschaft ausbreiten. Bei Körperschallausbreitung werden Schwingungen von der Quelle durch feste Stoffe (z. B. Fundamente, Boden, Decken oder Wände) zum Immissionsort hin übertragen. Die Ausbreitungswege können dabei sehr komplex sein. Am Einwirkungsort geben die Gebäudeteile die Körperschallschwingungen als sog. sekundären Luftschall in den Raum ab. Körperschallschwingungen können aber auch direkt über Hände, Füße oder den Körper vom Menschen (als Vibrationen) wahrgenommen werden. Tieffrequente Geräusche und Erschütterungen sind oftmals miteinander verknüpft. Das menschliche Ohr kann Luftdruckschwankungen im Infraschallbereich bis herab zu etwa 1 Hertz (1 Schwingung pro Sekunde) wahrnehmen. Allerdings ist das Ohr bei tiefen Frequenzen weniger empfindlich. So liegt die Hörschwelle bei 100 Hertz um 23 dB, bei 20 Hz schon über 70 dB. Bei 4 Hz liegt die Wahrnehmbarkeitsschwelle gar um 120 dB. Außerdem nehmen wir tieffrequente Geräusche anders wahr als mittel- oder hochfrequente. Im Frequenzbereich unter 20 Hz fehlen Tonhöhen- und Lautstärkeempfindung. Wir spüren die Luftdruckänderungen vielmehr als Pulsieren und Vibrationen, verbunden mit einem Druckgefühl auf den Ohren. Im Frequenzbereich von 20 Hz bis etwa 60 Hz nehmen wir Tonhöhen und Lautstärke kaum noch wahr. Vielfach empfinden wir „Schwebungen“. Ab 60 Hz findet der Übergang zur normalen Tonhöhen- und Geräuschempfindung statt. Der tieffrequente Schall lässt sich mit den herkömmlichen Beurteilungsmethoden, dem A-bewerteten Geräuschpegel angegeben in dB(A), nur schlecht erfassen. Daher wurden für diesen Frequenzbereich mit der Norm DIN 45680 „Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft“ (März 1997) spezielle Regeln aufgestellt. Trotz dieses Fortschrittes bei der Beurteilung sind tieffrequente Geräusche für die Behörden bisher schwer zu bestimmen, geschweige denn zu beseitigen. Dagegen empfinden Betroffene den Brummton als sehr lästig. 1999 und 2000 häuften sich in bestimmten Gebieten Baden-Württembergs und auch in Rheinland-Pfalz Klagen über einen Brummton. Die Betroffenen klagten über ein im Kopf auftretendes Dröhn-, Schwingungs- oder Druckgefühl, oft verbunden mit Angst- und Unsicherheitsempfindungen, sowie über eine Beeinträchtigung ihrer Leistungsfähigkeit. Daher beauftragte das Ministerium für Umwelt und Verkehr die Landesanstalt für Umweltschutz mit einer wissenschaftlichen Untersuchung zu der Frage, ob dieses so genannte „Brummton-Phänomen“ möglicherweise eine gemeinsame Ursache hat. Wichtigstes Ergebnis der Untersuchung war: Weder durch die akustischen Messungen allein noch durch den Abgleich mit den medizinisch-physiologischen Untersuchungen ließ sich eine gemeinsame Ursache oder Erklärung für das Brummton-Phänomen finden. |
| |||||||